Technisches Sicherheitsrecht
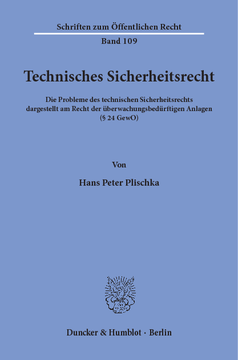
BOOK
Die Probleme des technischen Sicherheitsrechts, dargestellt am Recht der überwachungsbedürftigen Anlagen (§ 24 GewO)
- Authors: Plischka, Hans Peter
- Series: Schriften zum Öffentlichen Recht, Vol. 109
- (1969)
Book Details
Pricing
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Inhaltsübersicht | V | ||
| Inhaltsverzeichnis | VII | ||
| Abkürzungen | XIX | ||
| Einleitung: Gegenstand und Methode der Arbeit | 1 | ||
| A. Der Gegenstand der Arbeit | 1 | ||
| I. Technik und Recht | 1 | ||
| a) Die Bedeutung der Technik für die Entwicklung des öffentlichen Rechts | 1 | ||
| 1. Die Verwaltung als Daseins Vorsorge | 1 | ||
| 2. Die gewandelten Methoden der politischen Willensbildung | 1 | ||
| 3. Die Veränderungen der Kriegsführung und der internationalen Zusammenarbeit | 2 | ||
| 4. Die technisch bedingte Rationalisierung der Verwaltung | 2 | ||
| b) Das technische Sicherheitsrecht | 2 | ||
| 1. Die Sicherheitsprobleme der technischen Zivilisation | 2 | ||
| 2. Das technische Sicherheitsrecht als Weiterentwicklung des herkömmlichen Polizeirechts | 3 | ||
| 3. Das technische Sicherheitsrecht als Schranke für die technische Produktion der Wirtschaft | 3 | ||
| II. Das Recht der überwachungsbedürftigen Anlagen | 4 | ||
| B. Die Methode der Arbeit | 5 | ||
| I. Die Anknüpfung an das herkömmliche allgemeine Polizeirecht | 5 | ||
| a) Die polizeirechtlichen Probleme | 5 | ||
| b) Die verfassungsrechtlichen Probleme | 5 | ||
| II. Die Besonderheiten des technischen Sicherheitsrechts | 6 | ||
| a) Die Weiterentwicklung alter Rechtsfragen und die Herausbildung neuer Rechtsinstitute im technischen Sicherheitsrecht | 6 | ||
| b) Die Einheit des technischen Sicherheitsrechts auf dem Boden des Polizeirechts und die Gleichheit der sachlichen Problematik | 6 | ||
| c) Die charakteristischen Eigenheiten des technischen Regelungsobjektes | 6 | ||
| 1. Der technische Fortschritt | 11 | ||
| 2. Das technische Sicherheitsrisiko | 11 | ||
| 3. Die Rolle der Wirtschaft und der Wissenschaft | 11 | ||
| d) Die besonderen Rechtsinstitute des technischen Sicherheitsrechts | 11 | ||
| III. Die Eingrenzung der Arbeit | 12 | ||
| a) Die Beschränkung auf das materielle technische Sicherheitsrecht | 12 | ||
| b) Die Neukodifikation des Rechts der überwachungsbedürftigen Anlagen seit 1953 | 12 | ||
| 1. Teil: Das technische Sicherheitsrecht | 13 | ||
| 1. Kapitel: Das System des Sicherheitsrechts | 13 | ||
| § 1: Die technischen Sicherheitsvorschriften als Rechtsnormen | 13 | ||
| § 2: Die Auslegung technischer Vorschriften | 16 | ||
| A. Die Auslegung technisch-wissenschaftlicher Fachbegriffe | 17 | ||
| I. Die Bindung der Auslegung an die Begriffe der Fachwissenschaften | 18 | ||
| II. Die Selbständigkeit der juristischen Methode | 19 | ||
| a) Die Rechtsbegriffe als Zweckschöpfungen zur Ordnung des sozialen Zusammenlebens | 19 | ||
| b) Besondere Gesichtspunkte für die Auslegung des technischen Sicherheitsrechts | 21 | ||
| B. Möglichkeiten für die Berücksichtigung des technischen Fortschritts im Rahmen überholter technischer Begriffsbildungen | 21 | ||
| I. Die Notwendigkeit einer fortdauernden Anpassung des technischen Sicherheitsrechts an den Fortschritt der Technik | 22 | ||
| II. Die Fortbildung des technischen Sicherheitsrechts im Rahmen der Auslegung | 23 | ||
| a) Die Einbeziehung neuer gefährlicher Anlagen | 23 | ||
| b) Die Berücksichtigung neuer technischer Sicherheitsmaßnahmen | 24 | ||
| § 3: Das Sicherheitsrecht der überwachungsbedürftigen Anlagen als Polizeiverordnungsrecht des Bundes | 26 | ||
| A. § 24 als rechtsverbindliche Ermächtigungsnorm | 26 | ||
| B. Die Geltung der Grundsätze des allgemeinen Polizeirechts auf Bundesebene | 27 | ||
| C. Die Geltung dieser Grundsätze für die Spezialermächtigung des § 24 GewO | 27 | ||
| I. Die Besonderheiten der Spezialermächtigung für das Recht der überwachungsbedürftigen Anlagen | 27 | ||
| II. Die subsidiäre Geltung der Grundsätze des allgemeinen Polizeirechts | 29 | ||
| D. Ergebnis: § 24 GewO als Ermächtigung zu technischen Polizeiverordnungen des Bundes | 30 | ||
| § 4: Die allgemein anerkannten Regeln der Technik und die Rechtsquellen des technischen Sicherheitsrechts | 32 | ||
| A. Die sachliche Problematik eines technischen Sicherheitsrechts | 32 | ||
| I. Die Berücksichtigung des technischen Fortschritts | 32 | ||
| II. Die Beteiligung der interessierten und sachverständigen Kreise | 32 | ||
| III. Die Notwendigkeit detaillierter Einzelregelungen | 33 | ||
| B. Das System der Rechtsquellen des technischen Sicherheitsrechts | 34 | ||
| I. Die staatlich gesetzten Sicherheitsvorschriften | 34 | ||
| a) Das ermächtigende Gesetz § 24 GewO | 34 | ||
| b) Grundverordnungen und Technische Verordnungen | 34 | ||
| c) Die Allgemeinen Verwaltungsvorschriften | 37 | ||
| II. Die privaten technischen Regelwerke | 38 | ||
| a) Die VDE-Vorschriften | 39 | ||
| b) Die DIN-Normen | 40 | ||
| c) Die VDI-Regeln | 41 | ||
| d) Sonstige private technische Regelwerke | 41 | ||
| C. Die Rechtsnatur und die rechtliche Bedeutung der privaten technischen Regelwerke im System des technischen Sicherheitsrechts. Ihre unterschiedliche Bedeutung für das öffentliche Recht, das Bürgerliche Recht und das Strafrecht | 41 | ||
| I. Die mangelnde Rechtsnormqualität privater technischer Regelwerke | 42 | ||
| a) Ihre Rechtsverbindlichkeit als Rechtsverordnungen | 42 | ||
| b) Ihre Rechtsverbindlichkeit als autonome Satzungen | 43 | ||
| c) Ihre Rechtsverbindlichkeit als Gewohnheitsrecht | 44 | ||
| d) Ihre Rechtsverbindlichkeit als Bestandteil der staatlichen Rechtsverordnungen kraft Verweisung auf die „allgemein anerkannten Regeln der Technik | 44 | ||
| 1. Die Voraussetzungen der Verweisung im allgemeinen | 44 | ||
| aa) Bestimmtheit der Bezugnahme | 45 | ||
| bb) Bekanntmachung der in Bezug genommenen Vorschriften | 45 | ||
| 2. Unbestimmtheit und mangelnde Bekanntmachung der Verweisung auf die „allgemein anerkannten Regeln der Technik | 46 | ||
| II. Die Bedeutung der privaten technischen Regelwerke als Erfahrungssätze der Technik und die Voraussetzungen ihrer Anerkennung | 47 | ||
| a) Die allgemeine methodische Bedeutung der Blankettbegriffe als Mittel zur Bezugnahme auf außerrechtliche gesellschaftliche Standards | 49 | ||
| b) Die Auslegung des Blankettbegriffs der „allgemein anerkannten Regeln der Technik | 50 | ||
| 1. Die Bezugnahme auf allgemeine Erfahrungssätze der Technik als sachverständige gutachtliche Erkenntnismittel | 51 | ||
| 2. Die Voraussetzungen und Grenzen der Anerkennung | 51 | ||
| aa) Das Erfordernis der „allgemeinen Anerkennung | 52 | ||
| aaa) Geltung in der Praxis der ausübenden Techniker | 52 | ||
| bbb) Geltung als objektiv kontrollierbare, in Versuchen erprobte Erfahrungssätze | 53 | ||
| bb) Die Begrenzung durch den Zweck der „Gefahrenabwehr | 59 | ||
| aaa) Die Aufstellung privater technischer Regelwerke zu abweichenden Zwecken | 60 | ||
| bbb) Die Gefahr eines unzulänglichen Sicherheitsschutzes bei Überlassung an die interessierten Kreise | 61 | ||
| 2. Kapitel: Die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen des technischen Sicherheitsrechts | 63 | ||
| § 5: Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung des technischen Sicherheitsrechts | 63 | ||
| A. Die Kompetenz des Bundes zur Regelung des materiellen technischen Sicherheitsrechts unabhängig von der einschränkenden Regelung des § 24 II GewO | 64 | ||
| B. Die einzelnen Kompetenztitel | 65 | ||
| I. Die Zuständigkeit für das Recht des Gewerbes (Art. 74 Ziff. 11 GG) | 66 | ||
| II. Die Zuständigkeit für das Recht der Wirtschaft (Art. 74 Ziff. 11 GG) | 69 | ||
| a) Die Auslegung des Begriffs „Recht der Wirtschaft | 70 | ||
| 1. Engere Auffassung | 70 | ||
| 2. Weitere Auffassung | 70 | ||
| b) Die Abgrenzung zur Kompetenz der Länder für die Regelung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung | 71 | ||
| 1. Die sogenannte polizeiliche Annexkompetenz | 71 | ||
| 2. Die Voraussetzungen einer Annexkompetenz für das Recht der Wirtschaft | 71 | ||
| 3. Der Inhalt des polizeilichen Sicherheitsrechts im engeren Sinne | 74 | ||
| III. Die Zuständigkeit zur Regelung des Arbeitsschutzes (Art. 74 Ziff. 12 GG) | 75 | ||
| IV. Die Zuständigkeit zu Normungsaufgaben (Art. 73 Ziff. 4 GG) | 76 | ||
| V. Die Zuständigkeit für besondere Sachbereiche | 76 | ||
| C. Die Kompetenz des Bundes zur Regelung des formellen technischen Sicherheitsrechts | 77 | ||
| I. Die Zuständigkeit zur Regelung des Überwachungsverhältnisses (§ 24 I Ziff. 1, 2, 4 GewO) | 77 | ||
| II. Die Zuständigkeit zur Regelung der Organisation der Überwachung | 77 | ||
| a) Die Bestimmung der Behörden (§ 24 d GewO) | 77 | ||
| b) Die Bestimmung der technischen Überwachungsorganisationen (§ 24 c GewO) | 77 | ||
| D. Das Bedürfnis nach bundeseinheitlicher Regelung | 78 | ||
| § 6: Die Ermächtigung der Bundesregierung zur Regelung des technischen Sicherheitsrechts durch Rechtsverordnungen | 80 | ||
| A. Die Ermächtigung zu technischen Sicherheitsvorschriften (§ 24 I Ziff. 3 GewO) | 80 | ||
| I. Die Bestimmtheit der Ermächtigung nach Inhalt, Zweck und Ausmaß | 81 | ||
| a) Die Auslegung des Art. 80 I 2 GG, gesehen als Konkretisierung der Verfassungsgrundsätze der Rechtsstaatlichkeit und der Gewaltenteilung | 81 | ||
| b) Die Vereinbarkeit des § 24 I Ziff. 3 GewO mit Art. 80 I 2 GG | 82 | ||
| 1. Die Begrenzung auf die „Gefahrenabwehr | 82 | ||
| aa) Bestimmtheit kraft feststehender Auslegungspraxis in Rechtsprechung und Wissenschaft | 82 | ||
| bb) Notwendigkeit der Delegation von Rechtsetzungsbefugnissen auf die Exekutive wegen des Wandels und der Vielfalt der Verhältnisse | 83 | ||
| 2. Die Begrenzung durch einen gesetzlich festgelegten Anlagenkatalog in § 24 III GewO | 84 | ||
| 3. Die Begrenzung durch den nach § 24 I 3 GewO möglichen Regelungsinhalt | 85 | ||
| 4. Die Zulässigkeit einer bloßen Rahmenermächtigung | 85 | ||
| II. Der Adressat der Ermächtigung | 86 | ||
| B. Die Ermächtigung zur Regelung des Überwachungsverhältnisses (§ 24 I 1, 2 und 4 GewO) | 86 | ||
| § 7: Die Vereinbarkeit des technischen Sicherheitsrechts mit Art 12 und 14 GG | 88 | ||
| A. Die Vereinbarkeit mit der Eigentumsgarantie (Art. 14 GG) | 88 | ||
| I. Der polizeirechtliche Grundsatz der Entschädigungslosigkeit des Störers | 88 | ||
| II. Die Begründung und die näheren Voraussetzungen dieses Grundsatzes | 89 | ||
| a) Die Begründung dieses Grundsatzes an Hand der neueren Theorien zur Abgrenzung von Enteignung und entschädigungsloser Inhaltsbestimmung des Eigentums | 89 | ||
| 1. Kein Eingriff in schutzwürdige Belange (Bundesverwaltungsgericht) | 90 | ||
| 2. Zurückweisung in die für alle gleichermaßen geltenden Schranken (Bundesgerichtshof) | 90 | ||
| 3. Keine positive nutzbringende Inanspruchnahme privaten Eigentums (Bundesverfassungsgericht) | 90 | ||
| b) Die Entschädigungslosigkeit der Entziehung und Vernichtung polizeiwidrigen Eigentums | 92 | ||
| c) Die Geltung des Grundsatzes für die gefahrenabwehrende Staatstätigkeit im allgemeinen | 92 | ||
| 1. Die Nachprüfung des polizeilichen Charakters eigentumsbeschränkender Vorschriften | 92 | ||
| 2. Das technische Sicherheitsrecht als entschädigungslose Schrankenbestimmung für potentiell gefährliches Eigentum | 93 | ||
| B. Die Vereinbarkeit des präventiven Erlaubnisvorbehalts mit Art. 14 GG | 93 | ||
| C. Die Vereinbarkeit des technischen Sicherheitsrechts mit dem Grundrecht der Berufsfreiheit (Art. 12 GG) | 94 | ||
| 3. Kapitel: Die Voraussetzungen der gesetzlichen Ermächtigung des § 24 GewO | 96 | ||
| § 8: Die Begrenzung des technischen Sicherheitsrechts auf die Gefahrenabwehr | 96 | ||
| 1. Abschnitt: Die Gefahrenabwehr im technischen Sicherheitsrecht im allgemeinen | 96 | ||
| A. Die Zulässigkeit verbessernder, über den bisherigen Sicherheitsstandard hinausgehender technischer Anforderungen | 98 | ||
| I. Die Gefahrenabwehr als Abwehr von „Schaden | 98 | ||
| a) Schadensabwehr als Erhaltung „dessen, was schon da ist | 98 | ||
| b) Die Bestimmung der Ausgangsbasis zur Abgrenzung der gefahrenabwehrenden im Gegensatz zu wohlfahrtsfördernden Eingriffen | 99 | ||
| II. Die Unzulässigkeit des „Schutzes gegen sich selbst | 102 | ||
| B. Die Grenzen eines auf die Gefahrenabwehr beschränkten technischen Sicherheitsrechts | 103 | ||
| I. Die sich aus dem Begriff des „Schadens\" ergebenden Grenzen gegenüber fortdauernden Immissionsgefahren | 104 | ||
| II. Die sich aus der notwendigen „Wahrscheinlichkeit\" des Schadens ergebenden Grenzen gegenüber unvorhergesehenen Unfallgefahren gefährlicher Anlagen | 105 | ||
| a) Die Bestimmung des Wahrscheinlichkeitsgrades | 107 | ||
| 1. Die Bestimmung im Wege der Abwägung | 107 | ||
| 2. Die im einzelnen abzuwägenden Interessen | 110 | ||
| aa) Die Zulässigkeit eines gewissen technischen Risikos wegen der Berücksichtigung des technischen Fortschritts und der Belastungsfähigkeit der Wirtschaft | 110 | ||
| bb) Belege dafür aus sonstigen Rechtsvorschriften und aus der Literatur | 111 | ||
| aaa) Der Vergleich polizeilicher und zivilrechtlicher Gesetzeslösungen des Problems der technischen Sicherheit, insbesondere der Vergleich zur Gefährdungshaftung | 111 | ||
| bbb) Die Anerkennung des technischen Risikos in der Literatur | 115 | ||
| 3. Einzelne Anhaltspunkte für das Ergebnis der Abwägung | 117 | ||
| aa) Keine einseitige Risikoverteilung | 117 | ||
| bb) Berücksichtigung der bisher üblichen Maßstäbe | 117 | ||
| cc) Die Aufgabe der wissenschaftlichen Unfallforschung | 118 | ||
| b) Die objektive Nachweisbarkeit des drohenden Schadens | 119 | ||
| 1. Erfahrungen der Praxis und theoretische Berechnungen | 119 | ||
| 2. Beweislast bei noch unerforschten Gefahren | 120 | ||
| c) Die abstrakte Gefahr bei technischen Verordnungen | 121 | ||
| 2. Abschnitt: Die Voraussetzungen der Gefahrenabwehr nach § 24 GewO im besonderen | 122 | ||
| A. Der geschützte Personenkreis | 122 | ||
| I. Der Schutz der Beschäftigten | 122 | ||
| II. Der Schutz Dritter | 123 | ||
| III. Kumulativer oder alternativer Schutz der Beschäftigten und Dritten | 124 | ||
| B. Die geschützten Rechtsgüter | 125 | ||
| § 9: Der persönliche Geltungsbereich der technischen Vorschriften, insbesondere die polizeiliche Haftung der Hersteller | 126 | ||
| A. Die Polizeipflicht des Herstellers überwachungsbedürftiger Anlagen | 126 | ||
| I. Das Fehlen einer besonderen Ermächtigung in § 24 GewO | 127 | ||
| II. Der Rückgriff auf die Grundsätze des allgemeinen Polizeirechts | 129 | ||
| a) Die Polizeipflicht kraft Zustandshaftung | 130 | ||
| b) Die Polizeipflicht kraft Handlungshaftung | 130 | ||
| 1. Theorie von der conditio sine qua non | 130 | ||
| 2. Adäquanztheorie | 130 | ||
| 3. Theorie der unmittelbaren Überschreitung der Gefahrengrenze | 131 | ||
| 4. Theorie der rechtswidrigen Erfolgsverursachung | 132 | ||
| III. Die Praxis der Durchführungsverordnungen zu § 24 GewO | 133 | ||
| B. Die Polizeipflicht des Betreibers überwachungsbedürftiger Anlagen | 134 | ||
| C. Die Polizeipflicht des Eigentümers überwachungsbedürftiger Anlagen | 135 | ||
| D. Die Polizeipflicht der beschäftigten Arbeitnehmer an überwachungsbedürftigen Anlagen | 136 | ||
| I. Die Festsetzung von Verhaltensregeln für die Beschäftigten an überwachungsbedürftigen Anlagen durch die technischen Verordnungen | 136 | ||
| II. Die Verantwortlichkeit für die Einhaltung dieser Verhaltensregeln | 137 | ||
| a) Die Verantwortlichkeit des Betreibers | 137 | ||
| b) Die Verantwortlichkeit der Beschäftigten selbst | 137 | ||
| § 10: Das Regelungsobjekt des technischen Sicherheitsrechts: die einzelnen überwachungsbedürftigen Anlagen | 139 | ||
| A. Die historische Entwicklung des Katalogs der überwachungsbedürftigen Anlagen in § 24 III GewO | 139 | ||
| B. Die Auslegung der technischen Anlagenbegriffe | 140 | ||
| I. Die juristische, nicht technische Methode der Begriffsbildung | 140 | ||
| II. Das Verhältnis von Generalklausel (§ 24 I) und Enumeration (§ 24 III) | 141 | ||
| a) Das Erfordernis abstrakter Gefährlichkeit | 141 | ||
| b) Die Unzulässigkeit der analogen Einbeziehung weiterer technischer Anlagen | 142 | ||
| C. Die Zweckmäßigkeit der Enumeration durch Gesetz | 143 | ||
| I. Die Notwendigkeit von Spezialregelungen für das technische Sicherheitsrecht | 143 | ||
| II. Die Unzweckmäßigkeit einer gesetzlichen Festlegung des Anlagenkatalogs | 143 | ||
| § 11: Der sachliche Geltungsbereich des technischen Sicherheitsrechts | 145 | ||
| A. Die Auslegung des § 24 II GewO nach dem Wortlaut | 145 | ||
| B. Die Auslegung des § 24 II GewO aus der Entstehungsgeschichte | 146 | ||
| C. Die Abhängigkeit der Begriffsbildung in § 24 II GewO von den Begriffen des Kompetenzkataloges des Grundgesetzes in Art. 74 Ziff. 11 und 12 | 147 | ||
| I. Der Begriff des „wirtschaftlichen Unternehmens | 149 | ||
| II. Die Begrenzung nach dem Arbeitsschutzzweck | 150 | ||
| III. Die durch § 24 II nicht erfaßten überwachungsbedürftigen Anlagen | 150 | ||
| D. Die allgemeinen Bereichsausnahmen im technischen Sicherheitsrecht | 151 | ||
| 2. Teil: Das Überwachungsverhältnis | 153 | ||
| § 12: Das Überwachungsverhältnis im allgemeinen | 153 | ||
| A. Die Parteien des Überwachungsverhältnisses: die überwachenden Stellen | 153 | ||
| I. Die staatlichen Überwachungsbehörden | 153 | ||
| II. Die technischen Überwachungsorganisationen, insbesondere die Technischen Überwachungsvereine | 154 | ||
| B. Die durch die Überwachung betroffenen Personen. Die sachbezogene Anknüpfung der Adressierung | 155 | ||
| I. Die dingliche Adressierung der Rechtssätze | 155 | ||
| II. Die dingliche Adressierung der Errichtungs- und Betriebserlaubnisse | 156 | ||
| III. Die persönliche Adressierung der Einzelverfügungen | 156 | ||
| IV. Das besondere unmittelbare (dingliche) Überwachungsverhältnis der Aufsichtsbehörden zu den gefährlichen Anlagen | 156 | ||
| C. Der Inhalt des Überwachungsverhältnisses | 157 | ||
| I. Die einzelnen Überwachungsmaßnahmen | 157 | ||
| II. Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Grundlage. Kein umfassendes allgemeines Überwachungsverhältnis | 158 | ||
| III. Die Begrenzung auf die Gefahrenabwehr | 159 | ||
| § 13: Das Erlaubnisverfahren | 160 | ||
| A. Die erlaubnispilichtigen Anlagen und die Anknüpfungspunkte für die Erlaubniserteilung | 160 | ||
| I. Die Beschränkung der Erlaubnispflicht auf abstrakt gefährliche Anlagen | 160 | ||
| II. Die Erlaubnispflicht für die „Errichtung\" und den „Betrieb\" der überwachungsbedürftigen Anlagen | 162 | ||
| a) Errichtung und Betrieb als zeitlich aufeinander folgende Anknüpfungspunkte | 162 | ||
| b) Errichtung und Betrieb als sachlich sich entsprechende Erlaubnisgegenstände | 162 | ||
| III. Die Erlaubnispflicht des Herstellers | 164 | ||
| IV. Die „Wiedererrichtung\" und die erneute Inbetriebnahme | 164 | ||
| V. Die Erlaubnispflicht bei „wesentlichen\" Änderungen | 165 | ||
| B. Die Voraussetzungen der Erlaubniserteilung | 166 | ||
| C. Der Rechtsanspruch auf Erlaubniserteilung | 167 | ||
| I. Die Auslegung der Erlaubnis Vorschriften | 167 | ||
| II. Abweichende Ansichten | 168 | ||
| D. Die Zulässigkeit von Auflagen | 169 | ||
| I. Die Auslegung des § 24 I 2 GewO | 169 | ||
| II. Die Notwendigkeit einer gesetzlichen Ermächtigung für Auflagen im allgemeinen | 169 | ||
| a) Auflagen bei freien Erlaubnissen | 170 | ||
| b) Auflagen bei gebundenen Erlaubnissen | 170 | ||
| III. Der Vergleich zur Zulässigkeit selbständiger polizeilicher Verfügungen | 172 | ||
| IV. Schranken für die Zulässigkeit von Auflagen | 172 | ||
| E. Die Möglichkeit von Dispensen | 173 | ||
| F. Die Geltungskraft der Erlaubnis | 173 | ||
| I. Die Rechtsnatur der sogenannten dinglichen Erlaubnis | 175 | ||
| a) Die Annahme einer Übertragung der aus der Erlaubnis gewonnenen Rechte | 175 | ||
| b) Die Annahme einer an die Sache geknüpften Berechtigung | 176 | ||
| c) Die Erlaubniserteilung an persona certa und incerta | 176 | ||
| d) Die adressatlose Erlaubniserteilung | 176 | ||
| e) Die Untersuchung der Hechtsnatur an Hand der Abgrenzungskriterien von Verwaltungsakt und Norm | 177 | ||
| 1. Die Abgrenzungskriterien | 177 | ||
| 2. Die dingliche Erlaubnis als konkret-genereller Hoheitsakt | 178 | ||
| aa) Die Regelung eines Einzelfalles | 178 | ||
| bb) Die Betroffenheit einer Vielheit von Personen | 178 | ||
| 3. Die Einordnung konkret-genereller Akte als Verwaltungsakte | 179 | ||
| aa) Einzelfallregelung | 179 | ||
| bb) Personenmehrheit als Einheit | 179 | ||
| cc) Allgemeine Erwägungen | 179 | ||
| II. Die Geltung der Erlaubnis für alle dinglich Betroffenen | 180 | ||
| a) Die Bestimmung nach zivilrechtlichen Grundsätzen | 180 | ||
| b) Die Bestimmung nach den Grundsätzen über die polizeiliche Verantwortlichkeit | 180 | ||
| III. Die dingliche Adressierung der mit der Erlaubnis verbundenen Auflagen | 181 | ||
| § 14: Besondere Eingriffsbefugnisse der Aufsichtsbehörden | 182 | ||
| A. Die Aufsicht über die Einhaltung der technischen Vorschriften (§ 24 d, § 24 a II GewO) | 182 | ||
| I. Die Bedeutung des § 139 b GewO für die Gewerbeaufsichtsämter | 183 | ||
| a) § 139 b I 2 als Generalermächtigung der Gewerbeaufsicht zu Verfügungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes | 184 | ||
| 1. Die Zuständigkeit der Gewerbeaufsicht auf Grund einer Vielzahl von Spezialgesetzen | 184 | ||
| 2. Die Verfügungsbefugnis der Gewerbeaufsicht auf Grund spezieller Eingriffsermächtigungen | 185 | ||
| 3. Die Auslegung des § 139 b nach seinem Wortlaut | 185 | ||
| 4. Die historische Entwicklung des § 139 b | 186 | ||
| 5. Der Zweck des § 139 b | 187 | ||
| b) § 139 b I 2 als Verfügungsbefugnis zur Durchsetzung der einzelnen Arbeitsschutz Vorschriften | 189 | ||
| c) § 139 b I 2 als Ermächtigung zum Gebrauch von polizeilichen Zwangsmitteln | 189 | ||
| II. Die Zwangsbefugnisse der Gewerbeaufsichtsämter | 190 | ||
| a) Die Einstellungsanordnung nach § 24 a I und II | 190 | ||
| 1. Das Verhältnis zu anderen Zwangsbefugnissen | 191 | ||
| 2. Die Bindung eines besonders schwerwiegenden Eingriffs an besondere Voraussetzungen | 191 | ||
| b) Der Umfang der Zwangsbefugnisse im übrigen | 192 | ||
| III. § 139 b als bundesgesetzliche polizeiliche Ermächtigung | 193 | ||
| B. Die Befugnis zu selbständigen, konkrete Gefahren abwehrenden Sicherheitsmaßnahmen | 193 | ||
| I. Die Rechtsgrundlage in den Durchführungsverordnungen | 194 | ||
| II. Die gesetzliche Ermächtigung in § 24 I 3 | 194 | ||
| III. Die Grenzen der Verfügungsbefugnis | 195 | ||
| C. Die Befugnis zu nachträglichen selbständigen Anordnungen zur Gefahrenabwehr | 195 | ||
| I. Die Rechtsgrundlage | 196 | ||
| a) Die Abgrenzung zu § 25 III GewO | 196 | ||
| b) Die Voraussetzungen für die Zulässigkeit nachträglicher Anordnungen | 199 | ||
| II. Der Bestandsschutz für in Betrieb genommene Anlagen | 200 | ||
| a) Die Berufung auf die grundrechtliche Eigentumsgarantie | 200 | ||
| b) Die Abgrenzung zur gewerberechtlichen Bestandsgarantie des § 51 GewO | 201 | ||
| 1. Die Anwendbarkeit des § 51 auf nichterlaubnispflichtige Anlagen | 201 | ||
| 2. Der Begriff der Untersagung in § 51 | 202 | ||
| 3. Die Gleichstellung eigentumsbeschränkender Anordnungen mit der Untersagung des §51 | 203 | ||
| aa) Unmöglich ausführbare Anordnungen | 203 | ||
| bb) Wirtschaftlich nicht mehr vertretbare Anforderungen | 204 | ||
| cc) Vorläufige Betriebseinstellungen | 206 | ||
| c) Die Abgrenzung zur gewerberechtlichen Bestandsgarantie des § 25 I 1 GewO | 206 | ||
| 1. Die bisherige Auslegung des § 25 I 1: Unzulässigkeit nachträglicher Auflagen | 206 | ||
| 2. Derogation des § 25 I 1 durch § 25 III und § 24 I 3 mit Durchführungsverordnungen | 208 | ||
| D. Die Befugnis zu nachträglichen abhängigen Anordnungen zur Durchsetzung geänderter technischer Verordnungen | 209 | ||
| § 15: Die Typengenehmigung | 211 | ||
| A. Die Regelung der technischen Verordnungen | 211 | ||
| I. Die einheitliche Ausgestaltung des ZulassungsVerfahrens | 211 | ||
| II. Die verschiedenen Rechts Wirkungen der Typengenehmigung | 212 | ||
| a) Ersatz der Betriebserlaubnis | 212 | ||
| b) Wegfall der Abnahmeprüfung | 212 | ||
| c) Verwendungsverbot ohne Typengenehmigung | 212 | ||
| d) Die Typengenehmigung für einzelne Bauteile einer Anlage | 212 | ||
| III. Die sachliche Problematik | 213 | ||
| B. Die Rechtsnatur der Typengenehmigung | 214 | ||
| I. Die Auffassung des Bundesverfassungsgerichts | 215 | ||
| a) Rechtswirkungen der Typengenehmigung nur im Verhältnis zu den zukünftigen Betreibern | 215 | ||
| b) Die Typengenehmigung als Verwaltungsakt | 216 | ||
| II. Die Typengenehmigung als Bescheinigung der Ungefährlichkeit für den Hersteller | 217 | ||
| a) Der Inhalt und die Rechts Wirkungen der Typengenehmigung | 217 | ||
| 1. Kritik der Auffassung des Bundesverfassungsgerichts | 218 | ||
| aa) Mangelnde Bestimmtheit und mangelnde Bekanntmachung gegenüber den Betreibern | 218 | ||
| bb) Mangelnde Berücksichtigung der Stellung des Herstellers | 219 | ||
| 2. Bestimmung des Inhalts der Typengenehmigung an Hand der allgemeinen Kriterien für die Feststellung der Rechtsnatur eines Hoheitsaktes | 220 | ||
| aa) Zweck und Funktion des Hoheitsaktes | 220 | ||
| bb) Verfahrensmäßige Ausgestaltung | 223 | ||
| cc) Das Verhältnis von Typengenehmigung und Einzelerlaubnis | 224 | ||
| b) Die Typengenehmigung als Verwaltungsakt | 225 | ||
| C. Die einzelnen Arten der Typengenehmigung | 227 | ||
| I. Der Wegfall der Abnahmeprüfung | 227 | ||
| II. Verwendungsverbot ohne Typengenehmigung | 227 | ||
| D. Die nähere Ausgestaltung des Typengenehmigungsverfahrens | 228 | ||
| I. Die gesetzliche Grundlage | 228 | ||
| II. Die Einzelheiten des Verfahrens | 229 | ||
| a) Die Voraussetzungen der Zulassung und der Rechtsanspruch auf die Zulassung | 229 | ||
| b) Die Widerruflichkeit der Zulassung | 230 | ||
| III. Die Zuständigkeit der Länder zur Erteilung von Typengenehmigungen | 231 | ||
| a) Die Wirksamkeit von Verwaltungsakten der Länder im gesamten Bundesgebiet | 231 | ||
| b) Die bundesweite Wirksamkeit der Typengenehmigung für überwachungsbedürftige Anlagen | 233 | ||
| c) Die Beteiligung von Sachverständigengremien auf Bundesebene | 234 | ||
| Zusammenfassung | 235 | ||
| Literaturverzeichnis | 237 | ||
| Sachverzeichnis | 251 |
