Copyright Law, Urheberrecht und ihre Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft
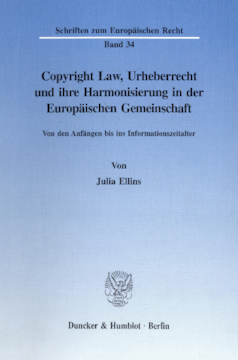
BOOK
Von den Anfängen bis ins Informationszeitalter
- Authors: Ellins, Julia
- Series: Schriften zum Europäischen Recht, Vol. 34
- (1997)
Book Details
Pricing
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsübersicht | 9 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 13 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 25 | ||
| Einleitung | 33 | ||
| Teil 1: Historische Fundamente von Copyright Law und Urheberrecht | 35 | ||
| Einführung | 35 | ||
| Kapitel 1: Geschichte des Copyright Law | 36 | ||
| 1. Printing patents | 36 | ||
| 2. Stationers’ Copyright | 37 | ||
| 3. Act of Anne | 41 | ||
| 4. Battle of the booksellers | 44 | ||
| 4.1. Millar v. Taylor | 47 | ||
| 4.2. Donaldson v. Beckett | 48 | ||
| 5. Ausbau des Copyright Law | 50 | ||
| 6. Copyright Act 1956 | 53 | ||
| 7. Copyright, Designs and Patents Act 1988 | 57 | ||
| Kapitel 2: Geschichte des Urheberrechts | 58 | ||
| 1. Privilegienzeitalter | 59 | ||
| 2. Unkontrollierbarer Büchernachdruck im territorial zersplitterten Deutschland als Wiege eigenständiger Urheberrechte | 62 | ||
| 3. Diskussion über Wesen und Inhalt des Urheberrechts | 68 | ||
| 4. Gesetzgebung bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts | 71 | ||
| 5. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte 1965 | 72 | ||
| Kapitel 3: Geschichtlich bedingte Grundansätze der Systeme | 74 | ||
| 1. Anfängliche Parallelen und Scheideweg der Rechtssysteme | 75 | ||
| 2. Grundkonzeptionen im Copyright Law und im Urheberrecht | 76 | ||
| 2.1. Schutz des Werkes bzw. des Urhebers als Ziel des Rechts | 76 | ||
| 2.2. Das Werk als vermarktbare Ware bzw. Verkörperung schöpferischer Identität | 78 | ||
| 2.3. Beziehung des Urhebers zum Werk | 78 | ||
| 3. Hintergrund der unterschiedlichen Ansätze | 79 | ||
| 3.1. Temporales Element | 79 | ||
| 3.2. Pragmatische Orientierung vs. Urheberrechtsphilosophie | 80 | ||
| 3.3. Rolle der Vertragsfreiheit | 80 | ||
| 3.4. Rechtliche Erfassung sozialer und wirtschaftlicher Gegebenheiten | 82 | ||
| 4. Zusammenfassung | 84 | ||
| Teil 2: Dichotomie von Copyright Law und Urheberrecht | 85 | ||
| Einführung | 85 | ||
| Kapitel 1: Werke und Leistungen | 86 | ||
| 1. Werkbegriff | 86 | ||
| 2. Vertikale und horizontale Dimensionen des Werkbegriffes | 88 | ||
| 2.1. Die vertikale Perspektive | 88 | ||
| 2.2. Die horizontale Perspektive | 89 | ||
| 3. Die vertikale Perspektive: Originalität | 90 | ||
| 3.1. Originalität zur Abgrenzung des Geschützten vom Ungeschützten | 90 | ||
| 3.1.1. Investitionsleistung | 91 | ||
| 3.1.2. Schöpfungsakt | 93 | ||
| 3.2. Hintergrund der unterschiedlichen Abgrenzung des Geschützten vom Ungeschützten | 97 | ||
| 3.2.1. Großbritannien | 97 | ||
| 3.2.1.1. Fehlen einer unfair competition-Generalklausel | 97 | ||
| 3.2.1.2. Hintergrund | 98 | ||
| 3.2.1.2.1. Vertragsfreiheit und Wettbewerbsfreiheit | 99 | ||
| 3.2.1.2.2. case law-System | 99 | ||
| 3.2.1.2.3. Flexibilität des Copyright Law | 100 | ||
| 3.2.2. Deutschland | 101 | ||
| 3.2.2.1. Ergänzender wettbewerbsrechtlicher Leistungsschutz | 101 | ||
| 3.2.2.2. Rechtsprechung zum ergänzenden wettbewerbsrechtlichen Leistungsschutz | 102 | ||
| 3.3. Gesamtbetrachtung | 103 | ||
| 4. Die horizontale Perspektive: Urheberrecht und Leistungsschutz | 105 | ||
| 4.1. Einführung | 105 | ||
| 4.2. Urheberrecht und Leistungsschutzrechte – copyright und die “verbannten” neighbouring rights | 107 | ||
| 4.2.1. Dichotomie von Urheberrecht und Leistungsschutzrechten im deutschen Recht | 107 | ||
| 4.2.1.1. Werk – Leistung | 107 | ||
| 4.2.1.2. Schöpferprinzip – Investitionsschutzprinzip | 108 | ||
| 4.2.1.3. Geschichtlicher Hintergrund | 109 | ||
| 4.2.2. Zurückweisung der Unterscheidung von copyright und neighbouring rights im britischen Recht | 110 | ||
| 4.2.2.1. Works | 110 | ||
| 4.2.2.2. Investitionsschutzprinzip | 111 | ||
| 4.2.2.3. Geschichtlicher Hintergrund | 112 | ||
| 4.2.2.4. Würdigung | 115 | ||
| 4.2.3. Gesamtbetrachtung | 117 | ||
| 4.3. Rechte an künstlerischen Darbietungen als Teil der Leistungsschutzrechte bzw. Außenseiter des Copyright Law | 118 | ||
| 4.3.1. Integration der Rechte an künstlerischen Darbietungen in die Leistungsschutzrechte des UrhG | 118 | ||
| 4.3.1.1. Geschichtlicher Hintergrund | 119 | ||
| 4.3.1.1.1. Ausübende Künstler | 119 | ||
| 4.3.1.1.2. Veranstalter künstlerischer Darbietungen | 120 | ||
| 4.3.1.2. Dogmatische Begründung | 120 | ||
| 4.3.2. Trennung der Rechte an künstlerischen Darbietungen vom Copyright-System im CDPA | 121 | ||
| 4.3.2.1. Geschichtlicher Hintergrund | 122 | ||
| 4.3.2.1.1. Ausübende Künstler | 122 | ||
| 4.3.2.1.2. Personen mit Aufnahmerechten an künstlerischen Darbietungen | 124 | ||
| 4.3.2.2. Dogmatische Begründung | 124 | ||
| 4.3.3. Gesamtbetrachtung | 126 | ||
| Kapitel 2: Urheber und Inhaber des Urheberrechts | 126 | ||
| 1. Begriffsbestimmung und Rechtsdogmatik: Urheber und Urheberrechtsinhaber | 127 | ||
| 1.1. Natürliche bzw. juristische Personen als Urheber und Inhaber des Urheberrechts | 127 | ||
| 1.1.1. Deutschland | 127 | ||
| 1.1.2. Großbritannien | 128 | ||
| 1.2. Hintergrund der unterschiedlichen Grundkonzeptionen | 129 | ||
| 1.2.1. Deutschland | 129 | ||
| 1.2.2. Großbritannien | 129 | ||
| 2. Inhaber des Urheberrechts bei angestellten Urhebern | 132 | ||
| 2.1. Die Rechtslage in Deutschland und Großbritannien | 132 | ||
| 2.1.1. Einheit von Urheberschaft und Inhaberschaft des Urheberrechts im deutschen Recht | 132 | ||
| 2.1.2. Trennung von authorship und first ownership of copyright im britischen Recht | 134 | ||
| 2.2. Hintergrund der unterschiedlichen Regelungen | 135 | ||
| 2.2.1. Naturrecht und Schöpferprinzip im Urheberrecht | 136 | ||
| 2.2.2. Positivismus, public interest und Investitionsschutzprinzip im Copyright Law | 137 | ||
| 2.3. Das Kräfteverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmerurheber in der Praxis | 139 | ||
| 2.3.1. Vermögensrechtliche Interessenlage | 140 | ||
| 2.3.1.1. Vermögensrechtliche Interessen des Arbeitgebers | 140 | ||
| 2.3.1.1.1. Deutschland | 140 | ||
| 2.3.1.1.2. Großbritannien | 143 | ||
| 2.3.1.2. Vermögensrechtliche Interessen des angestellten Urhebers | 144 | ||
| 2.3.1.2.1. Deutschland | 144 | ||
| 2.3.1.2.2. Großbritannien | 146 | ||
| 2.3.1.3. Gesamtbetrachtung | 146 | ||
| 2.3.2. Urheberpersönlichkeitsrechtliche Interessenlage | 150 | ||
| 2.4. Synopsis | 152 | ||
| Kapitel 3: Urhebervertragsrecht | 153 | ||
| 1. Grundsätzliches | 153 | ||
| 2. Gestaltung des Urhebervertragsrechts durch Gesetzgebung bzw. Rechtsprechung | 156 | ||
| 2.1. Umfang und Inhalt der Rechtseinräumung bei Vertragsschluß | 156 | ||
| 2.1.1. Übertragbarkeit | 156 | ||
| 2.1.1.1. Deutschland | 156 | ||
| 2.1.1.2. Großbritannien | 157 | ||
| 2.1.2. Einräumung von Nutzungsrechten | 158 | ||
| 2.1.2.1. Deutschland | 158 | ||
| 2.1.2.2. Großbritannien | 159 | ||
| 2.1.3. Noch unbekannte Arten der Verwertung | 160 | ||
| 2.1.3.1. Deutschland | 160 | ||
| 2.1.3.2. Großbritannien | 161 | ||
| 2.1.4. Formvorschriften | 161 | ||
| 2.1.4.1. Deutschland | 161 | ||
| 2.1.4.2. Großbritannien | 162 | ||
| 2.1.5. Vertragsauslegung | 162 | ||
| 2.1.5.1. Deutschland | 162 | ||
| 2.1.5.2. Großbritannien | 164 | ||
| 2.2. Korrekturen bei der Durchführung des Vertrages | 166 | ||
| 2.2.1. Deutschland | 167 | ||
| 2.2.1.1. Recht auf angemessene Beteiligung an den Erträgen unerwarteter Bestseller | 167 | ||
| 2.2.1.2. Kündigungsrecht bei Einräumung von Nutzungsrechten an künftigen Werken | 169 | ||
| 2.2.1.3. Rückruf wegen mangelnder oder unzureichender Verwertung | 169 | ||
| 2.2.1.4. Rückruf wegen gewandelter Überzeugung | 172 | ||
| 2.2.1.5. Vorausverzicht auf die genannten Rechte | 173 | ||
| 2.2.1.6. Anwendung bürgerlich-rechtlicher Vorschriften und Rechtsinstitute | 174 | ||
| 2.2.2. Großbritannien | 175 | ||
| 2.2.2.1. Der Problemfall | 176 | ||
| 2.2.2.2. Eingriff der Rechtsprechung | 177 | ||
| 2.2.2.2.1. Entscheidungen: Unreasonable Restraint of Trade und Undue Influence | 177 | ||
| 2.2.2.2.2. Diskussionspunkte | 179 | ||
| 3. Kollektivvertragliche Gestaltungsformen | 182 | ||
| 3.1. Deutschland | 183 | ||
| 3.2. Großbritannien | 184 | ||
| 3.3. Gesamtbetrachtung | 185 | ||
| 4. Fazit | 185 | ||
| Kapitel 4: Urheberpersönlichkeitsrecht | 188 | ||
| 1. Historische und rechtsdogmatische Grundlagen | 189 | ||
| 1.1. Ideelle und materielle Urheberinteressen | 189 | ||
| 1.1.1. Untrennbare Einheit im Urheberrecht | 189 | ||
| 1.1.2. Unüberbrückbare Dichotomie im Copyright Law | 189 | ||
| 1.2. Stellung des Werkes und seine Beziehung zum Urheber | 190 | ||
| 1.2.1. Das Werk als Emanation des Geistes im deutschen Recht | 190 | ||
| 1.2.2. Das Werk als Handelsware im britischen Recht | 190 | ||
| 1.3. Gesellschaftspolitische und philosophische Rahmenbedingungen | 191 | ||
| 1.3.1. Individualinteressen und Naturrecht im Urheberrechtssystem | 191 | ||
| 1.3.2. Interessen der Allgemeinheit und Positivismus im Copyright-System | 192 | ||
| 1.4. Antwort des Gesetzgebers auf die gesellschaftspolitischen und philosophischen Rahmenbedingungen | 193 | ||
| 1.4.1. Umfassender und spezifischer Schutz des Urhebers durch Gesetz | 193 | ||
| 1.4.2. Urheberschutz im Rahmen der allgemeinen Rechtsmittel des Common Law | 194 | ||
| 2. Gegenwärtige Rechtslage | 195 | ||
| 2.1. Überblick und Definitionen | 196 | ||
| 2.1.1. Urheberpersönlichkeitsrecht und moral rights | 196 | ||
| 2.1.2. Terminologisches | 197 | ||
| 2.2. Rechte, die in der RBÜ verankert sind | 198 | ||
| 2.2.1. Recht auf Anerkennung der Urheberschaft | 198 | ||
| 2.2.1.1. Positiver Aspekt: Urheberbezeichnungsrecht | 198 | ||
| 2.2.1.1.1. Deutschland | 198 | ||
| 2.2.1.1.2. Großbritannien | 200 | ||
| 2.2.1.1.2.1. Überblick über die Vorschriften des CDPA | 200 | ||
| 2.2.1.1.2.2. Vergleich des CDPA mit dem Common Law | 202 | ||
| 2.2.1.1.3. Gesamtbetrachtung | 205 | ||
| 2.2.1.2. Negativer Aspekt: Abwehr fremder Angriffe auf die Urheberschaft | 207 | ||
| 2.2.1.2.1. Deutschland | 207 | ||
| 2.2.1.2.2. Großbritannien | 208 | ||
| 2.2.1.2.2.1. Überblick über die Bestimmungen des CDPA | 208 | ||
| 2.2.1.2.2.2. Vergleich des CDPA mit dem Common Law | 210 | ||
| 2.2.1.2.3. Gesamtbetrachtung | 211 | ||
| 2.2.2. Recht auf Werkintegrität | 211 | ||
| 2.2.2.1. Deutschland | 211 | ||
| 2.2.2.2. Großbritannien | 214 | ||
| 2.2.2.2.1. Überblick über die Vorschriften des CDPA | 214 | ||
| 2.2.2.2.2. Vergleich des CDPA mit dem Common Law | 216 | ||
| 2.2.2.3. Gesamtbetrachtung | 217 | ||
| 2.3. Rechte, die nicht in der RBÜ verankert sind | 218 | ||
| 2.3.1. Veröffentlichungsrecht | 218 | ||
| 2.3.1.1. Deutschland | 218 | ||
| 2.3.1.2. Großbritannien | 220 | ||
| 2.3.1.3. Gesamtbetrachtung | 221 | ||
| 2.3.2. Recht gegen falsche Zuschreibung der Urheberschaft | 222 | ||
| 2.3.2.1. Deutschland | 222 | ||
| 2.3.2.2. Großbritannien | 222 | ||
| 2.3.2.3. Gesamtbetrachtung | 223 | ||
| 2.3.3. Recht am eigenen Bild | 224 | ||
| 2.3.3.1. Deutschland | 224 | ||
| 2.3.3.2. Großbritannien | 225 | ||
| 2.3.3.3. Gesamtbetrachtung | 225 | ||
| 2.4. Schutzdauer | 226 | ||
| 2.5. Synopsis | 226 | ||
| Teil 3: Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft | 230 | ||
| Einführung | 230 | ||
| Kapitel 1: Grundsätzliches | 231 | ||
| 1. Rahmenbedingungen | 231 | ||
| 1.1. Faktische Gesichtspunkte | 231 | ||
| 1.1.1. Dichotomie zwischen Copyright und Droit d’auteur | 231 | ||
| 1.1.2. Politische Natur des Einigungsprozesses | 234 | ||
| 1.1.3. Begrenzte Ressourcen | 237 | ||
| 1.2. Rechtliche Gesichtspunkte | 237 | ||
| 1.2.1. Kompetenz | 237 | ||
| 1.2.2. Subsidiarität | 239 | ||
| 1.2.3. Verhältnismäßigkeit | 240 | ||
| 1.2.4. Umsetzung der Harmonisierungsrichtlinien | 240 | ||
| 2. Phasen und Evolution der Harmonisierung | 242 | ||
| 2.1. Planungsphase | 242 | ||
| 2.2. Aktionsphase | 244 | ||
| 2.3. Zukunftsperspektiven | 246 | ||
| 3. Globaler Kontext | 247 | ||
| 3.1. Unilaterale Initiativen | 248 | ||
| 3.2. Bilaterale Aktivitäten | 249 | ||
| 3.3. Multilaterale Bewegungen | 251 | ||
| Kapitel 2: Brücken zwischen Copyright und Droit d’auteur | 254 | ||
| 1. Einführung | 254 | ||
| 2. Werke und Leistungen | 255 | ||
| 2.1. Problemstellung | 255 | ||
| 2.2. Harmonisierungsrahmen | 256 | ||
| 2.3. Vertikale Dimension: Originalität | 257 | ||
| 2.3.1. Computerprogramme | 257 | ||
| 2.3.2. Datenbanken | 259 | ||
| 2.3.3. Fotografien | 260 | ||
| 2.3.4. Würdigung | 261 | ||
| 2.4. Horizontale Dimension: Urheberrecht und Leistungsschutz | 262 | ||
| 2.4.1. Systemfragen | 262 | ||
| 2.4.2. Materielle Bestimmungen | 263 | ||
| 2.4.2.1. Harmonisierung spezifischer Rechte an Werken bzw. Leistungen aller Art | 263 | ||
| 2.4.2.1.1. Vermiet- und Verleihrecht und bestimmte andere Rechte | 263 | ||
| 2.4.2.1.2. Satellitensende- und Kabelweiterverbreitungsrecht | 265 | ||
| 2.4.2.2. Harmonisierung von Rechten an speziellen Schutzgegenständen | 267 | ||
| 2.4.2.2.1. Rechte an Computerprogrammen | 267 | ||
| 2.4.2.2.2. Rechte an Datenbanken | 268 | ||
| 2.4.3. Würdigung | 270 | ||
| 3. Urheber und Inhaber des Urheberrechts | 271 | ||
| 3.1. Problemstellung | 271 | ||
| 3.2. Harmonisierungsrahmen | 272 | ||
| 3.3. Harmonisierungsinitiativen | 274 | ||
| 3.3.1. Urheber und Urheberrechtsinhaber | 274 | ||
| 3.3.2. Arbeitnehmerurheberrecht | 277 | ||
| 3.3.3. Urheberschaft und Rechtsinhaberschaft am Filmwerk | 278 | ||
| 3.3.4. Würdigung | 279 | ||
| 4. Urhebervertragsrecht | 280 | ||
| 4.1. Problemstellung | 280 | ||
| 4.2. Harmonisierungsrahmen | 282 | ||
| 4.3. Harmonisierungsinitiativen | 283 | ||
| 4.3.1. Computerprogramm-Richtlinie | 284 | ||
| 4.3.2. Datenbank-Richtlinie | 284 | ||
| 4.3.3. Vermiet- und Verleihrecht-Richtlinie | 285 | ||
| 4.3.4. Würdigung | 286 | ||
| 5. Urheberpersönlichkeitsrecht | 286 | ||
| 5.1. Problemstellung | 286 | ||
| 5.2. Harmonisierungsrahmen | 289 | ||
| 5.3. Harmonisierungsfragen | 290 | ||
| 6. Schutzfristen | 292 | ||
| 6.1. Grundsätzliches | 293 | ||
| 6.1.1. Schutzdauer von Urheberrecht und Leistungsschutzrechten | 293 | ||
| 6.1.2. Bedeutung für Copyright- und Droit d’auteur-Systeme | 295 | ||
| 6.2. Sonderregeln | 296 | ||
| 6.2.1. Urheberrechtliche Bestimmungen | 298 | ||
| 6.2.2. Leistungsschutzrechtliche Bestimmungen | 300 | ||
| 6.3. Zeitliche Anwendbarkeit | 302 | ||
| 6.3.1. Lösungsmodelle | 302 | ||
| 6.3.2. Phil Collins-Urteil | 304 | ||
| 6.3.3. Wahrung erworbener Rechte | 306 | ||
| 6.4. Inländerbehandlung und materielle Gegenseitigkeit | 307 | ||
| 6.5. Verhältnis zu TRIPs | 309 | ||
| 7. Synopsis | 311 | ||
| Kapitel 3: Zukunftsprojekte | 313 | ||
| 1. Kurzfristige Pläne | 315 | ||
| 1.1. Droit de suite | 315 | ||
| 1.1.1. Das Pro: Beispiel Deutschland | 315 | ||
| 1.1.2. Das Contra: Beispiel Großbritannien | 316 | ||
| 1.1.3. Problem: grenzüberschreitende Umgehung des Droit de suite | 318 | ||
| 1.1.4. Bisherige Aktivitäten der EG-Kommission | 320 | ||
| 1.1.5. Richtlinienvorschlag | 321 | ||
| 1.2. Private Vervielfältigung | 322 | ||
| 1.2.1. Das Pro: Beispiel Deutschland | 323 | ||
| 1.2.2. Das Contra: Beispiel Großbritannien | 326 | ||
| 1.2.3. Problem: grenzüberschreitender Warenverkehr | 329 | ||
| 1.2.4. Bisherige Aktivitäten der EG-Kommission | 331 | ||
| 1.2.5. Möglicher Richtlinienvorschlag | 333 | ||
| 2. Langfristige Pläne | 336 | ||
| 2.1. Das ABC digitaler Technologie | 336 | ||
| 2.2. Rechtliche Rahmenbedingungen | 338 | ||
| 2.2.1. Handlungsbedarf auf Gemeinschaftsebene | 340 | ||
| 2.2.2. Der Wandel traditioneller Grundbegriffe | 341 | ||
| 2.2.2.1. Werke und Leistungen | 341 | ||
| 2.2.2.2. Urheber | 343 | ||
| 2.2.3. Der Wandel des Rechtemanagement | 344 | ||
| 2.2.3.1. Die upstream-Dimension: Urheber bzw. Leistungsschutzberechtigter – Produzent | 344 | ||
| 2.2.3.2. Die downstream-Dimension: Produzent – Nutzer | 347 | ||
| 2.2.4. Der Wandel etablierter Rechte | 349 | ||
| 2.2.4.1. Digitale Vervielfältigung | 349 | ||
| 2.2.4.2. Öffentliche Wiedergabe im digitalen Umfeld | 351 | ||
| 2.2.4.3. Digitale Verbreitung oder Übertragung | 351 | ||
| 2.2.4.4. Digitale Rundfunkübertragung | 352 | ||
| 2.2.5. Anwendung herkömmlicher Rechtsgrundsätze auf die neuen Dienstleistungen der Informationsgesellschaft | 353 | ||
| 2.2.5.1. Grundsätze für das auf transnationale on-line-Dienste anwendbare Recht | 353 | ||
| 2.2.5.2. Grundsätze der Rechtserschöpfung für die neuen on-line-Dienste? | 354 | ||
| 2.3. Fazit | 355 | ||
| Resümee | 357 | ||
| 1. Copyright Law | 357 | ||
| 1.1. Gestern | 357 | ||
| 1.2. Heute | 361 | ||
| 2. Urheberrecht | 366 | ||
| 2.1. Gestern | 366 | ||
| 2.2. Heute | 369 | ||
| 3. Harmonisierung in der Europäischen Gemeinschaft | 372 | ||
| 3.1. Heute | 372 | ||
| 3.2. Morgen | 377 | ||
| Schemata | 379 | ||
| Materialien | 383 | ||
| Australien | 383 | ||
| Deutschland | 383 | ||
| – Gesetzgebung (einschließlich Entwürfe) | 383 | ||
| – Rechtsprechung | 386 | ||
| – Sonstige Quellen | 388 | ||
| Europäische Gemeinschaft | 389 | ||
| – Gesetzgebung | 389 | ||
| * Verträge | 389 | ||
| * Verordnungen | 389 | ||
| * Richtlinien | 390 | ||
| – Rechtsprechung | 391 | ||
| * Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften | 391 | ||
| * Gericht erster Instanz | 393 | ||
| – Sonstige Rechtsakte und Quellen | 393 | ||
| Frankreich | 397 | ||
| Großbritannien | 398 | ||
| – Gesetzgebung (einschließlich Entwürfe) | 398 | ||
| – Rechtsprechung | 405 | ||
| – Sonstige Quellen | 408 | ||
| Internationaler Rahmen | 409 | ||
| – Multilaterale und bilaterale Abkommen | 409 | ||
| – Verhandlungen und Diskussionsrunden | 410 | ||
| Japan | 411 | ||
| Kanada | 411 | ||
| USA | 412 | ||
| – Gesetzgebung | 412 | ||
| – Rechtsprechung | 412 | ||
| – Sonstige Quellen | 412 | ||
| Literaturverzeichnis | 413 | ||
| Sachverzeichnis | 451 |
