Dogmatische und kriminologische Aspekte des Vikarierens von Strafe und Maßregel
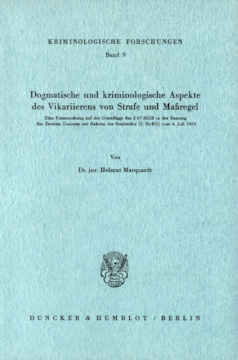
BOOK
Eine Untersuchung auf der Grundlage des § 67 StGB in der Fassung des Zweiten Gesetzes zur Reform des Strafrechts (2. StrRG) vom 4. Juli 1969
- Authors: Marquardt, Helmut
- Series: Kriminologische Forschungen, Vol. 9
- (1972)
Book Details
Pricing
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | 7 | ||
| Inhaltsverzeichnis | 9 | ||
| Abkürzungsverzeichnis | 14 | ||
| Einleitung | 15 | ||
| I. Die Aufgabenstellung der Untersuchung | 18 | ||
| II. Das Material und die Untersuchungsmethode | 19 | ||
| ERSTER TEIL: Das Prinzip des Vikariierens als strafrechtsdogmatisches und kriminalpolitisches Problem | 21 | ||
| I. Das Prinzip der Zweispurigkeit und seine Verwirklichung im geltenden Strafrecht | 21 | ||
| 1. Der Grundsatz der Tatschuldstrafe und seine Reichweite | 22 | ||
| a) Die Limitierungsfunktion der Schuld | 22 | ||
| b) Strafe als notwendige Folge von Schuld | 24 | ||
| c) Ergebnis | 28 | ||
| 2. Die (freiheitsentziehenden) Maßregeln. Voraussetzungen und Grenzen | 29 | ||
| 3. Die Reichweite des Prinzips der Zweispurigkeit | 29 | ||
| II. Der Grundsatz des Vikariierens | 34 | ||
| 1. Die Ausgestaltung im Gesetz (§ 67 i. d. F. des 2. StrRG) | 34 | ||
| 2. Die Grundgedanken der gesetzlichen Lösung | 35 | ||
| III. Die Einwände gegen das Vikariieren und seine Regelung im Gesetz | 36 | ||
| 1. Die strafrechtsdogmatischen Einwände | 36 | ||
| a) Widerspruch im System der Rechtsfolgen? | 36 | ||
| b) Verletzung des Schuldprinzips? | 38 | ||
| c) Unzulässige Übertragung von Straffunktionen auf die Maßregel? | 41 | ||
| 2. Die sonstigen Einwände | 43 | ||
| a) Ist die vikariierende Lösung ungerecht? | 43 | ||
| aa) Verstoß gegen Artikel 3 Absatz 1 GG? | 45 | ||
| bb) Verstoß gegen das allgemeine Gerechtigkeitsprinzip (Artikel 20 GG)? | 55 | ||
| cc) Das Ergebnis | 56 | ||
| b) Begünstigt die vikariierende Lösung die gefährlichen Täter? | 57 | ||
| c) Das mangelnde Verständnis der Öffentlichkeit für die vikariierende Lösung | 58 | ||
| d) Die Bewährung der Vikariierungsregeln in der richterlichen Praxis | 59 | ||
| ZWEITER TEIL: Die Darstellung des Untersuchungsmaterials | 61 | ||
| Vorbemerkung | 61 | ||
| Erster Abschnitt: Die mit Trinkerheilanstalt oder Entziehungsanstalt belegte Tätergruppe | 63 | ||
| A. Die Kriminalität nach Ausmaß und Erscheinungsform | 63 | ||
| I. Anlaßtat und Anlaßstrafe | 64 | ||
| 1. Die Anlaßtaten | 64 | ||
| a) Die Zahl der von der Gesamttätergruppe begangenen Taten | 64 | ||
| b) Die Deliktsarten | 65 | ||
| c) Die Modalitäten der Tatbegehung | 69 | ||
| aa) Tatgenossenschaft | 69 | ||
| bb) Die Betätigungsrichtung und die dabei entfaltete kriminelle Energie | 69 | ||
| a1) Diebstahlsdelikte | 69 | ||
| a2) Betrugsdelikte | 70 | ||
| a3) Körperverletzungsdelikte | 71 | ||
| a4) Widerstand gegen die Staatsgewalt | 71 | ||
| a5) Hausfriedensbruch | 72 | ||
| a6) Die im Vollrausch begangenen Taten | 72 | ||
| 2. Die neben der Einweisung ausgesprochenen Strafen (Anlaßstrafen) | 75 | ||
| II. Die Vorbestraftheit der Tätergruppe | 77 | ||
| 1. Die Vorstrafen der Täter | 77 | ||
| 2. Die neben den Vorstrafen angeordneten Maßregeln | 78 | ||
| 3. Art und Anzahl der von den Probanden begangenen Vortaten | 79 | ||
| B. Das Persönlichkeitsbild der nach § 42 c verurteilten Täter | 81 | ||
| I. Geschlecht, Alter und Kriminalitätsbeginn der Probanden | 81 | ||
| 1. Geschlecht | 81 | ||
| 2. Das Alter zur Zeit der Verurteilung nach § 42 c | 81 | ||
| 3. Der Beginn der kriminellen Laufbahn | 81 | ||
| II. Merkmale und Besonderheiten der Persönlichkeit | 82 | ||
| 1. Körperliche Auffälligkeiten und Krankheiten | 82 | ||
| 2. Die geistig-seelischen Merkmale | 82 | ||
| a) Geisteskrankheiten | 82 | ||
| b) Intelligenzdefekte | 83 | ||
| c) Die Persönlichkeitsstruktur der Probanden | 83 | ||
| III. Die Entwicklungsbedingungen der Probanden | 86 | ||
| IV. Die eigene Entwicklung der Probanden | 87 | ||
| 1. Ausbildung und Beruf | 87 | ||
| a) Schulbildung | 87 | ||
| b) Berufsausbildung | 88 | ||
| 2. Die unmittelbar vor der Einweisung ausgeübte Tätigkeit | 89 | ||
| 3. Der Familienstand und die familiären Verhältnisse der Probanden | 90 | ||
| a) Der Familienstand | 90 | ||
| b) Die familiären Verhältnisse der Probanden | 90 | ||
| Zweiter Abschnitt: Die nach § 42 b StGB (a. F.) verurteilte Tätergruppe | 92 | ||
| A. Die Kriminalität nach Ausmaß und Erscheinungsform | 92 | ||
| I. Anlaßtat und Anlaßstrafe | 92 | ||
| 1. Die Anlaßtaten | 92 | ||
| a) Die Zahl der Taten | 92 | ||
| b) Die Art der Taten | 93 | ||
| c) Die Modalitäten der Tatbegehung | 94 | ||
| aa) Tatgenossenschaft | 94 | ||
| bb) Die Betätigungsrichtung und die dabei entfaltete kriminelle Energie | 94 | ||
| a1) Die Sittlichkeitsdelikte | 95 | ||
| a2) Die Vermögensdelikte | 98 | ||
| a3) Die sonstigen Delikte | 102 | ||
| 2. Die neben der Einweisung ausgesprochenen Strafen (Anlaßstrafen) | 103 | ||
| II. Die Vorbestraftheit der Tätergruppe | 104 | ||
| 1. Die Vorstrafen | 104 | ||
| 2. Die neben den Vorstrafen angeordneten Maßregeln | 105 | ||
| 3. Die Vortaten | 105 | ||
| B. Das Persönlichkeitsbild der nach § 42 b verurteilten Probanden | 108 | ||
| I. Geschlecht und Alter | 108 | ||
| 1. Das Geschlecht | 108 | ||
| 2. Das Alter zur Zeit der Verurteilung nach § 42 b StGB | 108 | ||
| 3. Der Beginn der kriminellen Laufbahn | 108 | ||
| II. Merkmale und Besonderheiten der Persönlichkeit der Probanden | 109 | ||
| 1. Körperliche Auffälligkeiten und Erkrankungen | 110 | ||
| 2. Die geistig-seelischen Merkmale | 111 | ||
| a) Die Geisteskrankheiten | 111 | ||
| b) Die Intelligenzdefekte | 111 | ||
| c) Die Persönlichkeitsstruktur der Probanden | 112 | ||
| III. Die Entwicklungsbedingungen der Probanden | 114 | ||
| 1. Herkunft der Probanden | 114 | ||
| a) Herkunft nach Ehelichkeit und Unehelichkeit | 114 | ||
| b) Die soziale Herkunft | 114 | ||
| aa) Die Berufe der Väter der Probanden | 115 | ||
| bb) Die Familiengröße | 115 | ||
| 2. Die Erziehungsverhältnisse | 116 | ||
| a) Unvollständige oder fehlende Familie | 116 | ||
| b) Belastung des Erziehungsmilieus durch negative Eigenschaften der Eltern und Erziehungspersonen | 117 | ||
| IV. Die eigene Entwicklung der Probanden | 118 | ||
| 1. Ausbildung und Beruf | 118 | ||
| a) Schulausbildung | 118 | ||
| b) Berufsausbildung | 119 | ||
| 2. Die unmittelbar vor der Einweisung ausgeübte Tätigkeit | 120 | ||
| 3. Der Familienstand und die Familienverhältnisse der Probanden | 121 | ||
| DRITTER TEIL: Das Untersuchungsergebnis und seine Folgerungen | 123 | ||
| Erster Abschnitt: Die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und die Folgerungen für das vikariierende System | 123 | ||
| A. Die gegen die Einführung des Vikariierungsprinzips erhobenen Bedenken | 123 | ||
| I. Die angebliche Begünstigung gefährlicher Tätergruppen | 123 | ||
| 1. Die Gruppe der nach § 42 c StGB a. F. verurteilten Probanden | 123 | ||
| a) Das Ausmaß der Gefährlichkeit | 124 | ||
| b) Das Ausmaß der Begünstigung | 129 | ||
| 2. Die Gruppe der nach § 42 b StGB a. F. verurteilten Probanden | 135 | ||
| a) Das Ausmaß der Gefährlichkeit | 135 | ||
| b) Das Ausmaß der Begünstigung | 142 | ||
| II. Die Sorge um die Bewährung der Rechtsordnung und um das mangelnde Verständnis der Öffentlichkeit | 143 | ||
| B. Die Problematik der Schuldgrößenbestimmung | 146 | ||
| C. Der Wegfall der faktischen Doppelbestrafung | 147 | ||
| D. Das Vikariieren von Strafe und Sozialtherapeutischer Anstalt | 149 | ||
| I. Die Gefährlichkeit des Täterkreises | 150 | ||
| II. Die Begünstigung des Täterkreises durch das Vikariieren | 153 | ||
| III. Das Ergebnis | 155 | ||
| Zweiter Abschnitt: Die voraussichtliche Bewährung der Vikariierungsregeln in der richterlichen Praxis | 157 | ||
| A. Die Entscheidung über das Vikariieren im Erkenntnisverfahren | 157 | ||
| I. Das Problem der Strafzumessung | 157 | ||
| II. Die Möglichkeit der Durchbrechung des Vikariierungsgrundsatzes (§ 67 Abs. 2) | 160 | ||
| B. Die Entscheidung über das Vikariieren im Vollstreckungsverfahren | 162 | ||
| I. Die Regelung des § 67 Abs. 3 und 5 im allgemeinen | 162 | ||
| II. Einzelne Zweifelsfragen | 163 | ||
| C. Zusammenfassendes Ergebnis | 166 | ||
| Schlußwort | 169 | ||
| Literaturverzeichnis | 171 |
