Die Formel »Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit« bei der Abgrenzung von Tun und Unterlassen?
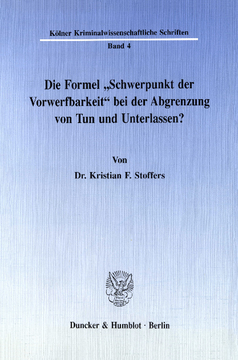
BOOK
- Authors: Stoffers, Kristian F.
- Series: Kölner Kriminalwissenschaftliche Schriften, Vol. 4
- (1992)
Book Details
Pricing
| Section Title | Page | Action | Price |
|---|---|---|---|
| Vorwort | V | ||
| Inhaltsverzeichnis | VII | ||
| Abkürzungsverzeichnis | XVII | ||
| 1. Abschnitt: Einführung in die Problematik (BGHSt. 6, 46) | 1 | ||
| 2. Abschnitt: Bedeutung der Formel “Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit” | 3 | ||
| A. Begriff der “Vorwerfbarkeit” | 3 | ||
| I. Bedeutung im strafrechtlichen Sinne | 3 | ||
| II. Geltung der strafrechtlichen Bedeutung für die Schwerpunktformel? | 4 | ||
| 1. Verständnis des BGH im “1. Kuppeleifall”(BGHSt. 6, 46) | 5 | ||
| 2. “Schwerpunktformel”-Rechtsprechung | 5 | ||
| a) OLG Stuttgart FamRZ 1959, 74 (“2. Kuppeleifall”) | 6 | ||
| b) BGH, unveröffentlichter Beschluß vom 15.12.1961 – 4 StR 376/61 (“3. Kuppeleifall”) | 6 | ||
| c) OLG Karlsruhe GA 1980, 429 (“Steuerüberlassungsfall”) | 7 | ||
| d) BGH bei Holtz, MDR 1982, 624 (“Mutterfall”) | 7 | ||
| e) OLG Düsseldorf JMBl. NW 1983, 199 (“Diabetesfall”) | 8 | ||
| f) OLG Frankfurt GA 1987, 549 (“Ausreisefall”) | 9 | ||
| g) Folgerung | 10 | ||
| 3. Interpretation im Schrifttum | 10 | ||
| 4. Sprachliche Deutung | 11 | ||
| 5. Fazit | 11 | ||
| B. Bedeutung der Formel “Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit” | 12 | ||
| 3. Abschnitt: Herleitung der von der Rechtsprechung angewandten Formel “Schwerpunkt der Vorwerfbarkeit” | 14 | ||
| A. Darstellung der Abgrenzungsmethode Mezger’s | 14 | ||
| B. Zustimmung in der Lehre | 15 | ||
| C. Vergleich der Methode Mezger’s mit der Schwerpunktformel der Rechtsprechung | 17 | ||
| I. Bedeutung des Kriteriums von Mezger | 17 | ||
| 1. Strafrechtliche Bedeutung des Begriffs “Vorwurf” | 17 | ||
| 2. Geltung der strafrechtlichen Bedeutung für die Abgrenzungsmethode Mezger’s? | 18 | ||
| a) Verständnis von Mezger | 18 | ||
| b) Interpretation im Schrifttum | 18 | ||
| c) Sprachliche Deutung | 19 | ||
| d) Fazit | 20 | ||
| 3. Bedeutung des Kriteriums von Mezger | 20 | ||
| II. Vergleich | 21 | ||
| 4. Abschnitt: Anwendung der Schwerpunktformel durch die Lehre | 23 | ||
| A. Unmittelbare Übernahme des Schwerpunktkriteriums | 23 | ||
| B. Modifizierende Ausformungen des Schwerpunktkriteriums | 25 | ||
| I. Unrechtsgehaltkriterium von Maurach | 25 | ||
| II. Meist-Handlungs-Richtlinie nach Schröder | 25 | ||
| III. Kombination des Schwerpunkt- und sozialen Handlungssinnkriteriums | 26 | ||
| 5. Abschnitt: Infragestellung der Abgrenzungsfunktion des Schwerpunktkriteriums | 28 | ||
| A. Differenzierung zwischen “echter” Abgrenzungsfrage und “mehrdeutigen” Verhaltensweisen | 28 | ||
| B. Anwendung der Schwerpunktformel nur bei ambivalentem Verhalten? | 29 | ||
| I. Überblick über die Fälle | 30 | ||
| II. Darstellung der Ausführungen | 38 | ||
| 1. Verfechter des Kriteriums der Richtung bzw. des Gegenstandes des rechtlichen Vorwurfs | 38 | ||
| a) Mezger | 39 | ||
| b) Zustimmende Lehre | 40 | ||
| aa) Blei | 40 | ||
| bb) Baumann | 43 | ||
| 2. Entscheidungen mittels der Schwerpunktformel in der Judikatur | 46 | ||
| 3. Befürworter der Schwerpunktformel in der Literatur | 48 | ||
| III. Resümee | 53 | ||
| C. Kritik am Schwerpunktkriterium | 54 | ||
| I. Kritik durch die Lehre mit gleichzeitiger Replik | 54 | ||
| II. Eigene Kritik | 58 | ||
| 1. Judikatur und die ihr unmittelbar folgende Literatur | 58 | ||
| 2. Modifizierende Ausformungen des Schwerpunktkriteriums in der Lehre | 62 | ||
| a) Unrechtsgehaltkriterium von Maurach | 62 | ||
| b) Meist-Handlungs-Richtlinie nach Schröder | 62 | ||
| c) Kombination des Schwerpunkt- und sozialen Handlungssinnkriteriums | 63 | ||
| 3. Mezger und die ihm zustimmenden Autoren | 63 | ||
| 4. Baumann | 67 | ||
| 6. Abschnitt: Vorrechtlich-ontologische Unterscheidung der Verhaltensformen positives Tun und Unterlassen | 69 | ||
| A. Darstellung der Abgrenzungstheorien | 69 | ||
| I. Rein naturalistische Betrachtungsweise nach dem äußeren Erscheinungsbild (Körperbewegungskriterium) | 70 | ||
| 1. Begründung durch v. Liszt | 70 | ||
| 2. Übernahme des Körperbewegungskriteriums | 70 | ||
| a) Das Schrifttum des frühen 20. Jahrhunderts | 71 | ||
| b) Das Schrifttum ab Mitte des 20. Jahrhunderts | 71 | ||
| II. Energiekriterium | 72 | ||
| 1. Begründung durch Engisch | 72 | ||
| 2. Resonanz in der Lehre | 75 | ||
| a) Übernahme der Energiethese in ihrer ursprünglichen Fassung | 75 | ||
| b) Verbindung des Energiekriteriums mit Kausalitätserwägungen | 76 | ||
| c) Kumulative Kombination von Kausalitäts- und Energiekriterium nach Sieber | 78 | ||
| III. Normativistische Betrachtungsweise nach Husserl | 81 | ||
| IV. Kriterium des Lebenssprachgebrauchs i.V.m. einer wertenden Betrachtungsweise von H. Mayer | 81 | ||
| V. Kriterium der sozialen Sinnbedeutung(-haftigkeit) des Verhaltens | 82 | ||
| 1. Die soziale Handlungslehre im Verständnis von Eb. Schmidt | 83 | ||
| 2. Die soziale Sinnbedeutung(-haftigkeit) des Verhaltens als Abgrenzungsmethode nach Eb. Schmidt | 83 | ||
| 3. Reaktion in der Lehre | 84 | ||
| VI. Kausalitätskriterium | 85 | ||
| 1. Begründung durch Armin Kaufmann | 85 | ||
| 2. Übernahme und Modifikation des Kausalitätskriteriums | 88 | ||
| a) Eigenkausalität oder Fremdkausalität nach Arthur Kaufmann | 88 | ||
| b) Kausalität oder Nichtkausalität des Verhaltens nach Welzel | 88 | ||
| c) Gesetzmäßige oder nicht gesetzmäßige Bedingung des Täters für die Rechtsgutslage nach Samson | 89 | ||
| d) Nichtwegdenken oder Hinzudenken eines bestimmten Verhaltens nach Bockelmann | 92 | ||
| e) Risikoerhöhungsprinzip i.V.m. Gefahrkriterium nach Stratenwerth | 92 | ||
| f) Motivationskriterium nach Jakobs | 93 | ||
| g) Ingangsetzen eines Kausalverlaufs oder Nichteingreifen in einen stattfindenden Kausalverlauf (weitere Autoren) | 93 | ||
| VII. Kriterium der Rechtsgutsbeeinträchtigung durch körperliche Aktivität oder Inaktivität nach Gössel | 94 | ||
| VIII. Weitere Abgrenzungstheorien | 95 | ||
| 1. Rechtspolitische Betrachtungsweise durch v. Dassel | 95 | ||
| 2. Kriterium des erlaubten Risikos von Ulsenheimer | 95 | ||
| 3. Eindrucksmoment nach Salm | 96 | ||
| B. Kritische Auseinandersetzung mit den Abgrenzungstheorien | 96 | ||
| I. Rein naturalistische Betrachtungsweise nach dem äußeren Erscheinungsbild (Körperbewegungskriterium) | 96 | ||
| II. Energiekriterium | 97 | ||
| 1. Energiekriterium im Verständnis von Engisch | 97 | ||
| 2. Verbindung des Energiekriteriums mit Kausalitätserwägungen | 101 | ||
| III. Normativistische Betrachtungsweise nach Husserl | 101 | ||
| IV. Kriterium des Lebenssprachgebrauchs i.V.m. einer wertenden Betrachtungsweise von H. Mayer | 102 | ||
| V. Kriterium der sozialen Sinnbedeutung(-haftigkeit) des Verhaltens | 103 | ||
| VI. Kriterium der Rechtsgutsbeeinträchtigung durch körperliche Aktivität oder Inaktivität nach Gössel | 104 | ||
| VII. Weitere Abgrenzungstheorien | 105 | ||
| 1. Rechtspolitische Betrachtungsweise durch v. Dassel | 105 | ||
| 2. Kriterium des erlaubten Risikos von Ulsenheimer | 105 | ||
| 3. Eindrucksmoment nach Salm | 106 | ||
| C. Eigener Lösungsvorschlag | 106 | ||
| I. Kausalität oder Nichtkausalität des Sich-Verhaltenden für den betreffenden konkreten Erfolg | 107 | ||
| 1. Begründung | 107 | ||
| a) Verneinung einer Kausalität der Unterlassung | 107 | ||
| b) Verneinung einer Kausalität des Unterlassungstäters | 108 | ||
| c) Hypothetische Kausalität bei den unechten Unterlassungsdelikten | 109 | ||
| d) Rechtfertigung der Notwendigkeit einer Garantenstellung beim Unterlassungstäter | 111 | ||
| 2. Mögliche Einwände | 113 | ||
| a) Kausalität der Unterlassung | 113 | ||
| b) Berechtigung der Kritik an den Ausführungen von Armin Kaufmann | 114 | ||
| aa) Infragestellung der Kausalbeziehung für das Verhältnis des aktiv Handelnden zu seiner Handlung | 115 | ||
| bb) Nichtwegdenkbarkeit des Unterlassenden (Kausalität des Unterlassungstäters) | 115 | ||
| cc) Untrennbarkeit von Unterlassendem und Unterlassung | 116 | ||
| dd) Unerheblichkeit der Hinwegdenkbarkeit des Unterlassers | 117 | ||
| ee) Resümee | 117 | ||
| c) Rechtsgutsverletzung statt Erfolg | 117 | ||
| d) Eingetretener statt betreffender konkreter Erfolg | 118 | ||
| e) Kausalität im allgemeinen Verbrechensaufbau | 118 | ||
| f) Fazit | 118 | ||
| II. Kritische Auseinandersetzung mit den diversen Ausformungen des Kausalitätskriteriums in der Lehre | 119 | ||
| 1. Kausalität oder Nichtkausalität des Verhaltens nach Welzel | 119 | ||
| 2. Kausalität oder Nichtkausalität des Menschen nach Armin Kaufmann | 119 | ||
| 3. Gesetzmäßige oder nicht gesetzmäßige Bedingung des Täters für die Rechtsgutslage nach Samson | 120 | ||
| 4. Eigenkausalität oder Fremdkausalität nach Arthur Kaufmann | 121 | ||
| 5. Nichtwegdenken oder Hinzudenken einesbestimmten Verhaltens nach Bockelmann | 122 | ||
| 6. Motivationskriterium nach Jakobs | 122 | ||
| 7. Risikoerhöhungsprinzip i.V.m. Gefahrkriterium nach Stratenwerth | 122 | ||
| 8. Ingangsetzen eines Kausalverlaufs oder Nichteingreifen in einen stattfindenden Kausalverlauf | 123 | ||
| 9. Verbindung des Energiekriteriums mit Kausalitätserwägungen | 123 | ||
| 7. Abschnitt: Behandlung mehrdeutiger Verhaltensweisen | 125 | ||
| A. Überblick über die Fälle | 125 | ||
| I. Fallgruppe der “Koinzidenz der Verhaltensformen” | 126 | ||
| II. Fallgruppe der “Sukzession der Verhaltensformen” | 136 | ||
| III. Fallgruppe des “falschen Handelns statt des richtigen Handelns” | 141 | ||
| B. Darstellung der Lösungsansätze | 142 | ||
| I. Wertungstheorien in Judikatur und Literatur | 142 | ||
| II. Werturteil i.S.v. H. Mayer | 142 | ||
| III. Kriterium der sozialen Sinnbedeutung des Verhaltens | 143 | ||
| 1. Begründung durch Eb. Schmidt | 143 | ||
| 2. Zustimmung in der Lehre (Hinzuziehung konkretisierender Maßstäbe) | 145 | ||
| a) Ranft | 146 | ||
| b) Heimann-Trosien/Wolff | 150 | ||
| 3. Anwendung bei den Reanimatorfällen | 153 | ||
| 4. Übernahme durch die Rechtsprechung | 153 | ||
| IV. Vorrangige Frage nach der Kausalität eines positiven Tuns (Subsidiaritätslösung) | 155 | ||
| 1. Begründung durch Grünwald | 155 | ||
| 2. Weiterentwicklung von Roxin | 157 | ||
| 3. Übernahme und Modifikation in der Lehre | 165 | ||
| a) Frage nach der tatbestandsmäßigen Erfolgsverursachung durch ein objektiv tatbestandsmäßiges positives Tun durch Jescheck | 165 | ||
| b) Frage nach dem Vorliegen eines objektiv tatbestandsmäßigen Tuns seitens Eser | 167 | ||
| c) Vorrangige Prüfung der Erfolgsverursachung durch eine Handlung des Täters nach Rudolphi | 168 | ||
| d) Vorrangiges Abstellen auf das kausale aktive Tun (Betrachtung als Scheinproblem infolge des negativen Handlungsbegriffs) von Herzberg | 171 | ||
| e) Vorrangige Prüfung des Vorliegens eines volldeliktischen aktiven Tuns durch Noll | 173 | ||
| f) Vorrangige Frage nach dem kausalen Tun seitens Fünfsinn | 174 | ||
| g) Frage nach der Kausalität eines Energieeinsatzes und – bei deren Vorliegen – Entscheidung nach Konkurrenzregeln durch Seelmann | 175 | ||
| h) Einordnung weiterer Autoren (Rittler, Boldt, Lüderssen, Otter, Burgstaller, Schultz, Küpper) | 176 | ||
| 4. Anwendung durch die Judikatur | 179 | ||
| a) OLG Hamburg VRS Bd. 25 (1963), 433 | 179 | ||
| b) OLG Karlsruhe GA 1980, 429 (“Steuerüberlassungsfall”) | 180 | ||
| c) BGHSt. 31, 48 (“Buscopanfall”): Beweisnotsituation | 181 | ||
| V. Zerlegungsverfahren | 181 | ||
| 1. Begründung durch Böhm | 181 | ||
| 2. Zustimmung von Schlüchter | 184 | ||
| VI. Zweifellösung | 186 | ||
| 1. Begründung durch Schröder | 186 | ||
| 2. Weiterentwicklung in der Lehre | 187 | ||
| a) Spendet | 187 | ||
| b) Arthur Kaufmann | 189 | ||
| VII. Kausalitätskriterium bei ambivalentem Verhalten | 190 | ||
| 1. Kausalität oder Nichtkausalität des Menschen nach Armin Kaufmann | 190 | ||
| 2. Kausalität oder Nichtkausalität des Verhaltens nach Welzel | 194 | ||
| 3. Gesetzmäßige oder nicht gesetzmäßige Bedingung des Täters für die Rechtsgutslage nach Samson | 195 | ||
| 4. Nichtwegdenken oder Hinzudenken eines bestimmten Verhaltens nach Bockelmann | 198 | ||
| VIII. Entscheidung nach Art der verletzten Rechtsnorm durch Wiethölter | 200 | ||
| IX. Kriterium des komplexen Verhaltens nach Androulakis | 201 | ||
| X. Infragestellung der Unterscheidungsproblematik bei mehrdeutigen Verhaltensweisen | 203 | ||
| 1. Leugnung der Unterscheidungsnotwendigkeit | 204 | ||
| a) Einordnung als Scheinproblem seitens Ulsenheimer | 204 | ||
| b) Betrachtung als eigentlich gegenstandslos durch Binavince (Weitere Vertreter) | 204 | ||
| 2. Leugnung der Unterscheidungsmöglichkeit | 207 | ||
| a) Fragwürdigkeit nach Sahn | 207 | ||
| b) These einer Verwandtschaft von Tun und Unterlassen von Arzt | 208 | ||
| 3. Evidenz oder Obsoleszenz der Unterscheidung nach Volk | 208 | ||
| XI. Objektive Zurechnungslehren | 212 | ||
| 1. Vermeidbarkeitsprinzip i.S.v. Kahrs | 212 | ||
| 2. Risikoerhöhungsprinzip (Subsidiaritätsprinzip) nach Stratenwerth | 213 | ||
| 3. Risikoerhöhungsprinzip von Otto | 214 | ||
| XII. Einordnung als Konkurrenzproblem | 217 | ||
| 1. Anwendung der Kategorien der Konkurrenzlehre durch Welp | 218 | ||
| 2. Einstufung als ein Konkurrenzproblem seitens Jakobs | 220 | ||
| 3. Lösung auf der Konkurrenzebene durch Sieber | 222 | ||
| XIII. Kriterium der Schutzrichtung des Achtungsanspruchs eines Rechtsgutsobjekts | 223 | ||
| 1. Begründung durch Schmidhäuser | 223 | ||
| 2. Zuspruch in der Lehre | 227 | ||
| a) Achtungsanspruch des Rechtsguts nach Kruse | 227 | ||
| b) Position des Rechtsguts i.S.v. R. Zimmermann | 227 | ||
| XIV. Normativierung des Energiekriteriums durch Engisch | 229 | ||
| XV. Primat des strafbarkeitsausschöpfenden Tuns | 236 | ||
| 1. Begründung von Kienapfel | 236 | ||
| 2. Zustimmung in der Strafrechtswissenschaft | 238 | ||
| XVI. Kriterium der Rechtsgutsbeeinträchtigung durch körperliche Aktivität oder Inaktivität nach Gössel | 240 | ||
| XVII. Gegensteuerungskonzept von Behrendt | 242 | ||
| C. Kritische Auseinandersetzung mit den Lösungsansätzen | 244 | ||
| I. Normative Lösungsvorschläge | 244 | ||
| 1. Wertungstheorien in Judikatur und Literatur | 244 | ||
| 2. Werturteil i.S.v. H. Mayer | 244 | ||
| 3. Kriterium der sozialen Sinnbedeutung des Verhaltens | 245 | ||
| II. Methoden mit vorrangiger Anknüpfung an ein Tun | 249 | ||
| 1. Zweifellösung | 249 | ||
| 2. Primat des strafbarkeitsausschöpfenden Tuns | 251 | ||
| 3. Vorrangige Frage nach der Kausalität eines positiven Tuns (Subsidiaritätslösung) | 252 | ||
| III. Zerlegungsverfahren | 256 | ||
| IV. Infragestellung der Unterscheidungsproblematik bei mehrdeutigen Verhaltensweisen | 257 | ||
| 1. Leugnung der Unterscheidungsnotwendigkeit | 258 | ||
| 2. Leugnung der Unterscheidungsmöglichkeit | 259 | ||
| 3. Evidenz oder Obsoleszenz der Unterscheidung nach Volk | 262 | ||
| V. Kausalitätskriterium bei ambivalentem Verhalten | 264 | ||
| VI. Objektive Zurechnungslehren | 268 | ||
| VII. Kriterium der Schutzrichtung des Achtungsanspruchs eines Rechtsgutsobjekts | 272 | ||
| VIII. Normativierung des Energiekriteriums durch Engisch | 273 | ||
| IX. Weitere Lösungsvorschläge | 275 | ||
| 1. Entscheidung nach Art der verletzten Rechtsnorm durch Wiethölter | 275 | ||
| 2. Kriterium des komplexen Verhaltens nach Androulakis | 276 | ||
| 3. Kriterium der Rechtsgutsbeeinträchtigung durch körperliche Aktivität oder Inaktivität nach Gössel | 277 | ||
| 4. Gegensteuerungskonzept von Behrendt | 278 | ||
| 5. Beweisnotsituation | 278 | ||
| D. Eigener Lösungsvorschlag | 279 | ||
| I. Mehrstufiges Prüfungsverfahren | 279 | ||
| II. Die verschiedenen Fallgruppen | 283 | ||
| 1. Koinzidenz der Verhaltensformen | 284 | ||
| a) Fälle aus dem Bereich der Fahrlässigkeitsdelinquenz | 285 | ||
| b) Fallkonstellationen des Abbruchs rettender Kausalverläufe | 302 | ||
| c) Sonstige problematische Sachverhalte | 317 | ||
| d) Entscheidung auf der Konkurrenzebene | 323 | ||
| 2. Sukzession der Verhaltensformen | 324 | ||
| a) Fehlende Notwendigkeit einer Entscheidung auf der Konkurrenzebene | 325 | ||
| aa) Allgemeine Fälle aus dem Bereich der Fahrlässigkeits- und der Vorsatzdelinquenz | 325 | ||
| bb) Fallgruppe der “omissio libera in causa” | 332 | ||
| cc) Fälle der Bestimmung eines anderen zur Unterlassung von Rettungshandlungen | 336 | ||
| b) Entscheidung auf der Konkurrenzebene | 337 | ||
| aa) Fälle mit identischer innerer Tatseite und übereinstimmendem Unrechts- sowie Schuldgehalt der Verhaltensformen | 337 | ||
| bb) Fahrlässigkeits-Vorsatz-Kombinationen | 339 | ||
| 3. Falsches Handeln statt richtiges Handeln | 341 | ||
| E. Exkurs: Die unterschiedliche Beurteilung einiger besonderer gleichgelagerter Fallkonstellationen der psychischen Beihilfe durch die Rechtsprechung im Hinblick auf die Einordnung als positives Tun oder Unterlassen | 342 | ||
| I. Einordnung als positives Tun | 342 | ||
| II. Einordnung als Unterlassen | 345 | ||
| III. Eigene Stellungnahme | 347 | ||
| 1. Kritische Untersuchung einiger Entscheidungen | 347 | ||
| 2. Allgemeine Erwägungen | 353 | ||
| F. Exkurs: Judikatur zu Fallkonstellationen des Abbruchs einer rettenden Kausalreihe und Fällen der aktiven Teilnahme an einem Unterlassungsdelikt | 354 | ||
| 8. Abschnitt: Auseinandersetzung mit der Rechtsfigur “Unterlassen durch Tun” | 358 | ||
| A. Entwicklung in der Strafrechtswissenschaft | 358 | ||
| I. Begründung durch Merkel | 358 | ||
| II. Befürwortende Autoren zu Beginn des 20. Jahrhunderts | 360 | ||
| III. Fortführung durch v. Overbeck | 361 | ||
| IV. Wiederentdeckung, Wiederbelebung und Weiterentwicklung in den sechziger Jahren | 364 | ||
| V. Befürworter im aktuellen Schrifttum | 364 | ||
| B. Dogmatische Herleitung | 365 | ||
| C. Anwendungsbereich | 367 | ||
| D. § 221 Abs. 1 2. Alt. StGB als gesetzlich normierter Fall? | 371 | ||
| E. Kritische Würdigung | 372 | ||
| I. Dogmatische Bedenken | 373 | ||
| II. Praktische Bedenken | 376 | ||
| 1. Fallgruppe des Rücktritts vom Gebotserfüllungsversuch | 376 | ||
| 2. Fallgruppe der “omissio libera in causa” | 380 | ||
| 3. Fallgruppe der aktiven Teilnahme an einem Unterlassungsdelikt | 381 | ||
| 4. Fallgruppe der Vereitelung fremder Rettungsbemühungen | 384 | ||
| 9. Abschnitt: Behandlung der Reanimatorproblematik | 386 | ||
| A. Darstellung der Theorien in der Literatur | 387 | ||
| I. Konzeptionen zur Begründung eines straflosen Unterlassens | 387 | ||
| 1. Sozialer Sinn des Verhaltens | 387 | ||
| a) Begründung durch Geilen | 388 | ||
| b) Zustimmung im Schrifttum | 389 | ||
| aa) Lenckner | 389 | ||
| bb) Küper | 389 | ||
| cc) Schwalm | 390 | ||
| dd) Kienapfel | 390 | ||
| ee) Leonardy | 390 | ||
| ff) Stree | 390 | ||
| gg) Lackner (Weitere Befürworter) | 391 | ||
| 2. Schwerpunktkriterium | 391 | ||
| a) Schwerpunkt des Verhaltens (Weißauer/Opderbecke) | 392 | ||
| b) Kombination des Schwerpunkt- und sozialen Handlungssinnkriteriums | 393 | ||
| aa) Wessels | 393 | ||
| bb) Haft | 394 | ||
| cc) Hanack | 395 | ||
| dd) Krey | 395 | ||
| 3. Unterlassen durch Tun | 395 | ||
| a) Begründung durch Roxin | 395 | ||
| b) Zuspruch in der Lehre | 399 | ||
| aa) Herzberg | 399 | ||
| bb) Eser (Weitere Vertreter) | 399 | ||
| 4. Normativierung des Energiekriteriums durch Engisch (Kamps) | 401 | ||
| 5. Schutzrichtung des Achtungsanspruchs eines Rechtsgutsobjekts nach Schmidhäuser | 403 | ||
| 6. Position des Rechtsguts | 404 | ||
| a) Begründung durch R. Zimmermann | 404 | ||
| b) Bestätigung seitens v. Dellingshausen | 406 | ||
| II. Konstruktionen zur Begründung von Straflosigkeit trotz Annahme eines positiven Tuns | 407 | ||
| 1. Fehlen des objektiven Tatbestandes nach Hirsch (Küpper) | 407 | ||
| 2. Tatbestandsausschluß wegen Haftungsbegrenzung der Tötungsdelikte | 408 | ||
| a) Einschränkung des Tötungsverbotes nach Samson | 408 | ||
| b) Tatbestandsausschluß wegen Haftungsbegrenzung durch den Schutzzweck der Norm i.S.v. Sax (Weitere Verfechter) | 411 | ||
| c) Haftungsbeschränkung im Wege einer Rückbesinnung auf die hinter dem Tötungsverbot stehenden Interessen nach Möllering | 414 | ||
| d) Teleologische Reduktion der Tötungsdelikte i.S.v. Rudolphi | 416 | ||
| 3. Verneinung der Rechtswidrigkeit | 418 | ||
| a) Rechtfertigung wegen Herstellung der Behandlungsfreiheit nach Otto | 418 | ||
| b) Rechtfertigung nach den Grundsätzen der passiven Euthanasie nach Horn | 420 | ||
| c) Rechtfertigungsgrund des § 34 StGB durch Herzberg | 421 | ||
| 4. Entschuldigende Pflichtenkollision nach Gössel | 421 | ||
| 5. Passive Sterbehilfe von Stratenwerth (Arzt) | 422 | ||
| III. Strafbares Begehungsdelikt i.S.v. Bockelmann (Schlüchter) | 423 | ||
| IV. Unerheblichkeit der Einordnung als Tun oder Unterlassen | 425 | ||
| 1. Zulässigkeit des Verhaltens nach Eser | 425 | ||
| 2. Rechtmäßigkeit des Verhaltens nach Dölling | 426 | ||
| 3. Nichterfüllung eines Tötungstatbestandes nach Tröndle | 426 | ||
| 4. Berücksichtigung weiterer Autoren | 427 | ||
| V. Reformbedürftigkeit (§ 214 AE-Sterbehilfe) | 428 | ||
| B. Beschäftigung mit der Reanimatorproblematik in der Judikatur | 429 | ||
| I. Das Urteil des LG Ravensburg | 430 | ||
| II. Das Urteil des LG Bonn | 433 | ||
| C. Kritische Auseinandersetzung mit den Theorien in der Literatur | 434 | ||
| I. Konzeptionen zur Begründung eines straflosen Unterlassens | 434 | ||
| 1. Sozialer Sinn des Verhaltens | 436 | ||
| 2. Schwerpunktkriterium | 438 | ||
| 3. Unterlassen durch Tun | 439 | ||
| 4. Normativierung des Energiekriteriums durch Engisch | 442 | ||
| 5. Schutzrichtung des Achtungsanspruchs eines Rechtsgutsobjekts nach Schmidhäuser | 444 | ||
| 6. Position des Rechtsguts | 445 | ||
| II. Strafbares Begehungsdelikt i.S.v. Bockelmann | 446 | ||
| III. Unerheblichkeit der Einordnung als Tun oder Unterlassen | 448 | ||
| IV. Konstruktionen zur Begründung von Straflosigkeit trotz Annahme eines positiven Tuns | 449 | ||
| 1. Tatbestandsausschluß wegen Haftungsbegrenzung der Tötungsdelikte | 450 | ||
| 2. Verneinung der Rechtswidrigkeit | 454 | ||
| 3. Entschuldigende Pflichtenkollision nach Gössel | 456 | ||
| 4. Passive Sterbehilfe von Stratenwerth | 457 | ||
| D. Eigener Lösungsvorschlag | 457 | ||
| I. Begründung für das Abstellen auf ein positives Tun | 458 | ||
| II. Begründung für das Vorliegen von Straflosigkeit | 459 | ||
| III. Frage nach der Reformbedürftigkeit (§ 214 AE-Sterbehilfe) | 465 | ||
| IV. Anmerkungen zur Beschäftigung mit der Reanimatorproblematik in der Judikatur | 467 | ||
| 10. Abschnitt: Zusammenfassung und Ausblick | 470 | ||
| Literaturverzeichnis | 477 |
